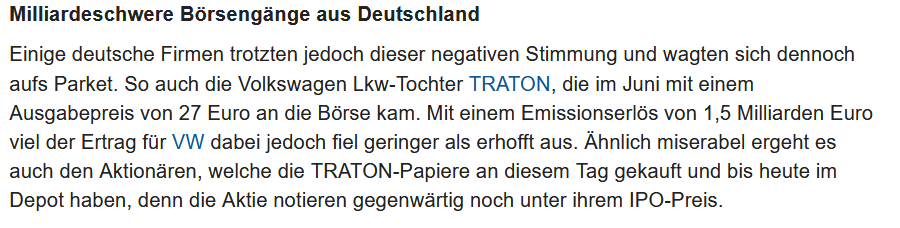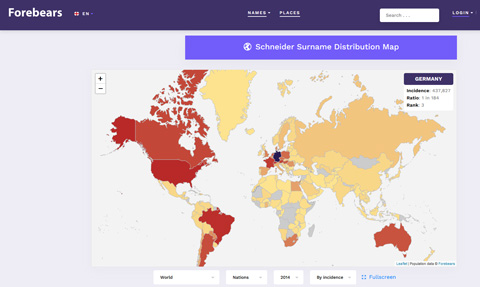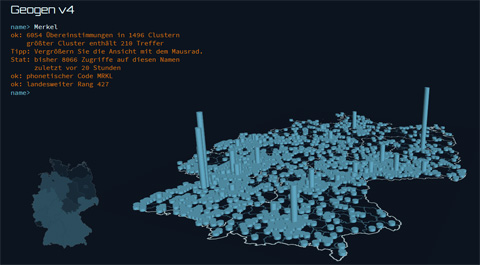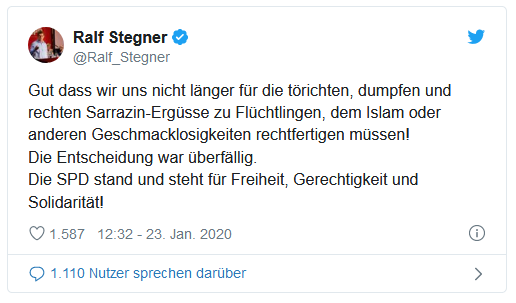Tempo steht für Taschentücher. Manchmal tritt solch ein bekannter Markenname an die Stelle eines Gattungsbegriffs. Ganz selten geschieht das auch mit Menschen. Eine Forschungsarbeit zeigt, welche Promis dafür am häufigsten verwendet werden.
 Fast zwei Millionen Dokumente aus fast 25 Jahren „New York Times“ und „Die Zeit“ haben die vier Forscher Robert Jäschke, Jannik Strötgen, Elena Krotova und Frank Fischer auf der Suche nach sogenannten „Vossianischen Antonomasien“ untersucht. Diese rhetorischen Perlen kommen nicht allzu häufig vor, aber wenn, dann sorgen sie für viel Aufmerksamkeit. Kein Wunder, denn ihre Wirkung ist stark: Man kann damit Menschen ganz schön niedermachen oder erhöhen, je nachdem. „Er ist der Galileo Galilei der Formel 1“ oder „Das ist ein Steve Jobs für Arme“ sind Beispiele für derlei Vossianische Antonomasien.
Fast zwei Millionen Dokumente aus fast 25 Jahren „New York Times“ und „Die Zeit“ haben die vier Forscher Robert Jäschke, Jannik Strötgen, Elena Krotova und Frank Fischer auf der Suche nach sogenannten „Vossianischen Antonomasien“ untersucht. Diese rhetorischen Perlen kommen nicht allzu häufig vor, aber wenn, dann sorgen sie für viel Aufmerksamkeit. Kein Wunder, denn ihre Wirkung ist stark: Man kann damit Menschen ganz schön niedermachen oder erhöhen, je nachdem. „Er ist der Galileo Galilei der Formel 1“ oder „Das ist ein Steve Jobs für Arme“ sind Beispiele für derlei Vossianische Antonomasien.
Bevor wir die Ergebnisse verraten, schildern wir noch in wenigen Worten, warum dieses rhetorische Mittel einen so verrückten Namen trägt und was eigentlich sein Charakteristikum ist:
1. Die Vossianischen Antonomasien sind benannt nach dem niederländischen Gelehrten Gerhard Johannes Vossius (1577-1649), der sie als erster beschrieben hat. „Vossantos“, wie sie von den Forschern liebevoll genannt werden, gibt’s mindestens seit der Antike. Platon etwa wurde einmal „Homer der Philosophie“ genannt.
2. Es handelt sich um eine Spezialform der Antonomasie. Diese funktioniert so: Man ersetzt den Namen einer Person durch eine Eigenschaft, um den Namen nicht zu oft zu benutzen: „Der Leimener“ anstatt „Boris Becker“. Die Vossianische Antonomasie allerdings verwendet wiederum einen Eigennamen, um eine Bezeichnung zu ersetzen: „Der Boris Becker unter den Philosophen“. Bei manchen, wie unserem titelgebenden „Gregor Gysi der FDP“, bleibt zunächst offen, welche Eigenschaft eigentlich gemeint ist. Seine Redekunst? Seine Körpergröße? Sein Charme?
Aber wer sind nun heute die Namen, die für Vossantos am häufigsten verwendet werden? In ihrer Studie „Der Helmut Kohl unter den Brotaufstrichen“ listen die Forscher die Promis nach Ländern geteilt auf – in den USA werden natürlich andere Namen verwendet als in Deutschland.
DIE ZEIT (1995 bis 2011):
1. Robin Hood
2. Bill Gates
3. Franz Beckenbauer
4. Daniel Düsentrieb
Heinz Rühmann
James Dean
Jesus Christus
Norbert Blüm
Willy Brandt
NEW YORK TIMES (1987 bis 2007):
1. Michael Jordan
2. Michelangelo
3. Babe Ruth
4. Don Quixote
Elvis
Neil Young
Rodney Dangerfield
Zelig
In der Studie wird übrigens auch ausgewertet, welche Ressorts am häufigsten Vossantos verwenden: Hier liegt in beiden Ländern das Feuilleton weit vorn, dahinter folgen in der ZEIT die Politik, in der NYT hingegen der Sport.
Wer sich an Vossianischen Antonomasien erfreut, findet in dem Blog „Der Umblätterer“ fast 500 Beispiele eines Sammlers …








 Fast zwei Millionen Dokumente aus fast 25 Jahren „New York Times“ und „Die Zeit“ haben die vier Forscher Robert Jäschke, Jannik Strötgen, Elena Krotova und Frank Fischer auf der Suche nach sogenannten „Vossianischen Antonomasien“ untersucht. Diese rhetorischen Perlen kommen nicht allzu häufig vor, aber wenn, dann sorgen sie für viel Aufmerksamkeit. Kein Wunder, denn ihre Wirkung ist stark: Man kann damit Menschen ganz schön niedermachen oder erhöhen, je nachdem. „Er ist der Galileo Galilei der Formel 1“ oder „Das ist ein Steve Jobs für Arme“ sind Beispiele für derlei Vossianische Antonomasien.
Fast zwei Millionen Dokumente aus fast 25 Jahren „New York Times“ und „Die Zeit“ haben die vier Forscher Robert Jäschke, Jannik Strötgen, Elena Krotova und Frank Fischer auf der Suche nach sogenannten „Vossianischen Antonomasien“ untersucht. Diese rhetorischen Perlen kommen nicht allzu häufig vor, aber wenn, dann sorgen sie für viel Aufmerksamkeit. Kein Wunder, denn ihre Wirkung ist stark: Man kann damit Menschen ganz schön niedermachen oder erhöhen, je nachdem. „Er ist der Galileo Galilei der Formel 1“ oder „Das ist ein Steve Jobs für Arme“ sind Beispiele für derlei Vossianische Antonomasien.