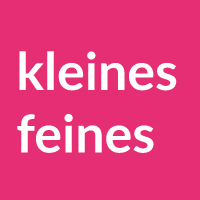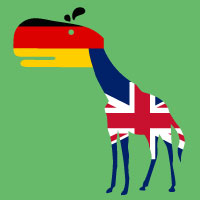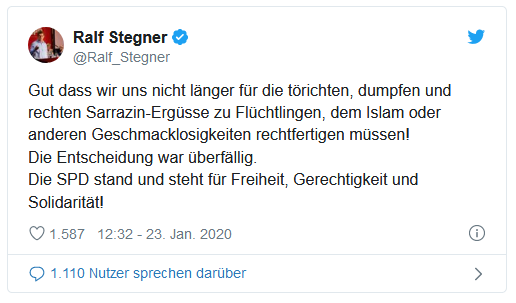„Sie schrieb mir gestern.“ In welcher Zeitform steht dieser Satz? Die einen nennen sie Imperfekt, die anderen Präteritum. Aber sind diese beiden Formen identisch und warum existieren dafür zwei Begriffe? Eine kurze Erklärung zu einer Zeitform, die in der gesprochenen Sprache beinahe ausgestorben ist.
„Sie schrieb mir gestern.“ In welcher Zeitform steht dieser Satz? Die einen nennen sie Imperfekt, die anderen Präteritum. Aber sind diese beiden Formen identisch und warum existieren dafür zwei Begriffe? Eine kurze Erklärung zu einer Zeitform, die in der gesprochenen Sprache beinahe ausgestorben ist.
Von Andrea Rayers
Wenn Sie gefragt werden: Welche Zeitform ist „ging“? Dann reicht es völlig aus, wenn Sie antworten: Imperfekt oder Präteritum. Im Alltag können Sie diese beiden Begriffe getrost synonym verwenden, wie es auch etliche Nachschlagewerke tun – Hauptsache, Sie grenzen sie von der zweiten Vergangenheitsform, dem Perfekt, ab. Fragen Sie hingegen einen Linguisten, wird der Ihnen in aller Regel antworten: „Wir sagen lieber Präteritum.“ Warum?
Imperfekt
Der Begriff Imperfekt stammt aus den romanischen Sprachen und bedeutet „unvollendete Vergangenheit“. Im Französischen zum Beispiel passt der Name „Imparfait“ gut: Damit werden sich wiederholende und andauernde Handlungen beschrieben, die noch nicht abgeschlossen sind und bis in die Gegenwart reichen. Im Deutschen ist das anders: „Ich ging über die Straße“ heißt nun mal, dass das Ereignis schon abgeschlossen ist und keineswegs „unvollendet“.
Präteritum
Das Präteritum entstammt dem Lateinischen und bedeutet schlicht „vergangen“. Und das drückt eben viel besser aus, was das Präteritum soll: eine Handlung skizzieren, die nicht unvollendet ist und bis in die Gegenwart reicht, sondern abgeschlossen hinter uns liegt.
Ob Präteritum oder Imperfekt: In der gesprochenen Sprache wird diese Vergangenheitsform heute ohnehin kaum noch gebraucht – höchstens bei Modal- und Hilfsverben wie „war“, „musste“, „hatte“ oder „sollte“. Nicht umsonst lernen Kinder den Unterschied so: Das Präteritum ist die schriftliche Vergangenheitsform, das Perfekt die mündliche.