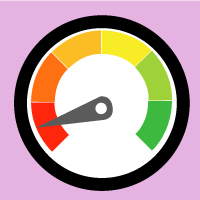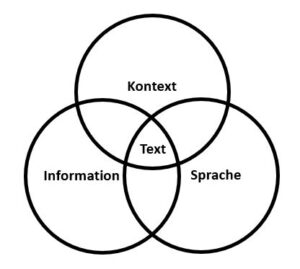„Live-Journalismus“ ist international groß im Kommen. Aber was genau wird da geboten? Wir haben dazu Jochen Markett befragt, der mit seiner Firma diese Shows in Deutschland voranbringt.

Große Bühne: Jochen Markett als Moderator beim Jahresfinale eines Reporter Slams. Foto: Vic Harster
Wenn wir vom Live-Journalismus sprechen, kann man sich das als Abendveranstaltung vorstellen, als Alternative zu Kino, Theater oder Lesung?
Ja, das ist eine schöne Kulturalternative. Normalerweise verbindet man mit Journalismus ja eher Zeitung lesen, Fernsehen gucken, Radio hören oder Online-Medien konsumieren. Aber es gibt seit ungefähr 13 Jahren international den Trend, Journalismus auf die Bühne zu bringen. Die Amerikaner haben damit angefangen und dann sind viele europäische Länder nachgezogen, eben auch wir in Deutschland. Und es ist tatsächlich ein Kulturerlebnis im Theater oder einer sonstigen Kultur-Location. Man sitzt als Zuschauer im Publikum und sieht Journalistinnen und Journalisten auf der Bühne, die von ihren Recherchen erzählen.
Und der Begriff dafür heißt „Live-Journalismus“? Es hieß ja auch schon mal „Reporter Slam“ oder „Jive“ …
Ja, das Genre nennt sich Live-Journalismus. Der Begriff ist in Deutschland noch nicht so etabliert, wir arbeiten aber daran. International ist der englische Begriff „Livejournalism“ schon wesentlich gesetzter. Die anderen Begriffe sind unsere Shownamen, die wir nach und nach entwickelt haben. Wir haben 2016 damit begonnen, sogenannte Reporter Slams zu machen. Das ist ein Unterhaltungswettbewerb auf der Bühne. Mehrere Reporterinnen und Reporter treten gegeneinander an in einem Wettbewerb, wer am besten von einer eigenen Recherche erzählen kann. Und am Ende wählt das Publikum dann den sogenannten Slampion. International sind wir die Einzigen, die das so als Wettbewerb organisieren.

Journalist, Moderator, Unternehmer und Medientrainer in einer Person: Jochen Markett. Foto: Andi Weiland
Jochen Markett, selbst gelernter Journalist, hat mit Christine Liehr und Christoph Herms die Firma Headliner gegründet, um Live-Journalismus auf deutsche Bühnen zu bringen. Jochen Markett lebt in Potsdam und ist mit dem Zeilenhacker-Team seit vielen Jahren durch gemeinsame Seminare kollegial verbunden. Seine Spezialität ist es, Schreiben und Spaß unter einen Hut zu bringen. Das gesamte Interview mit vielen weiteren Aspekten des Live-Journalismus‘ finden Sie hier.
Sehe ich das richtig, dass die Reporter Slams den bekannteren Poetry Slams ähneln? Es tritt einer nach dem anderen auf und am Ende wird bewertet, wer den besten Auftritt hatte?
Ganz genau. Poetry Slams waren international die ersten erfolgreichen Slams. Die Autoren haben damit begonnen, eben nicht nur Gedichte, sondern auch Prosa auf die Bühne zu bringen. Dieses Format ist ja seit vielen Jahren weltweit erfolgreich. Dann sind andere Berufsgruppen nachgezogen bei diesem Erfolgsmodell, vor allen Dingen Wissenschaftler. Wir haben gedacht, wenn Wissenschaftler es schaffen, unterhaltsam von ihren Forschungen zu berichten, dann müssten es doch Reporter auch schaffen, unterhaltsam von ihren Recherchen zu erzählen. Und das gab es aber irgendwie nicht. So haben wir also die Marktlücke entdeckt und dann in einem Coworking-Café in Neukölln zum ersten Mal einen eigenen Reporter Slam angeboten – der war dann direkt ausverkauft mit 170 Zuschauern. Und da haben wir gesehen: Das funktioniert, das Feedback war sehr positiv. Und so haben wir das dann regelmäßig fortgesetzt. Bis heute haben wir etwa 60 Slams gemacht, bundesweit und inzwischen auch in sechs Länder exportiert.
Nach welchen Kriterien wählt ihr die Reporter:innen aus?
Da haben wir unterschiedliche Wege gefunden. In den ersten Jahren haben wir einfach geguckt, welche lustigen Reporter wir kennen, auf welche lustigen Themen sind wir zuletzt gestoßen. Dann sind aber zunehmend auch Redaktionen an uns herangetreten, haben selbst Leute empfohlen. Und es gab und gibt auch Reporter, die sich selbst ins Gespräch gebracht haben. So war das auch mal bei einer Jahressiegerin, die vorher bei uns im Publikum saß, begeistert war von dem Format und sich dann eben selbst angeboten hat. Das war eine Sportreporterin, die über den ältesten Fan von Hertha BSC Berlin eine sehr rührende Geschichte erzählt hat.

Die Journalisten stellen ihre Recherchen mit Bildern, Videos und anderen Elementen vor – so unterhaltsam wie möglich, aber inhaltlich möglichst auch substanziell. Hier stellt Lorin Kadiu gerade seine Recherche vor, in der er die Baupolitik in der albanischen Hauptstadt Tirana als skandalös und verlogen entlarvt. Foto: Vic Harster
Kannst du mal eine beispielhafte Recherche schildern, die ihr auf die Bühne geholt habt?
Ja, vielleicht das Beispiel des letzten Jahresfinals, wo es eine für uns überraschende Siegerin gab. Sie heißt Kathleen Kröger und ist Lokalreporterin in Erfurt für die Thüringer Allgemeine. Ihr war beim Spazieren durch Erfurt aufgefallen, dass es dort an alten DDR-Schulgebäuden so ein Dekorationselement gibt, das aussieht wie ein Fisch. Und da hat sie sich gedacht: Soll das wirklich ein Fisch sein? Und warum? Sie hat das dann auf Twitter gestellt, wo sie gar nicht so viele Follower hatte. Aber als sie ihren Account danach wieder öffnete, hatte sie hunderte Kommentare und merkte, wow, dieses Thema beschäftigt viele Menschen, die dann darüber spekuliert und diskutiert haben, ob das jetzt Fische sind oder nicht. Und dann hat sie den Architekten aufgetrieben, der damals diese Dekorationselemente geplant hat. Der hat darin gar nicht unbedingt Fische gesehen, wusste aber, dass viele darin einen Fisch sehen. Dieses kleine Nischenthema hat sie so skurril und liebevoll und unterhaltsam vorgestellt, dass sie damit unser Jahresfinale gewonnen hat. Für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, dass auch der gute alte Lokaljournalismus auf der großen Bühne reüssieren kann. Es muss einfach eine gute Story geben und Überraschungselemente, es muss liebevoll erzählt sein, die richtigen Zutaten enthalten und damit das Publikum begeistern. Insofern eignet sich jede Geschichte, wenn sie nur richtig erzählt ist.
Wie messt ihr das Gefallen des Publikums und bestimmt den Sieger?
Das entscheiden wir je nach Show. Beim Jahresfinale entscheiden wir immer mit Online-Voting. Da kann man sich dann auf einer Seite einloggen und seinen Favoriten wählen. So können auch die Zuschauer an den Bildschirmen mitentscheiden. Bei den nicht live übertragenen Slams machen wir meistens eine Abstimmung per Applausometer. Da gewinnt also der- oder diejenige, die den lautesten Applaus bekommt im Saal, nicht den längsten, sondern den mit dem größten Dezibel-Ausschlag. Der Nachteil ist, wenn man vorne Jubelperser platziert hat und die schreien dann laut beim Schlussapplaus, dann zieht das den Dezibel-Ausschlag nach oben und kann die Abstimmung verzerren. Da gibt es dann schon mal Diskussionen am Ende, ob das jetzt eine faire Entscheidung war oder nicht. Der Vorteil des Applausometers ist, dass man am Ende noch mal einen tobenden Saal hat und bei der Schlussabstimmung jeder noch mal einen großen, lauten Applaus bekommt. Das ist dann einfach ein fantastisches Stimmungsfinale. Das fehlt etwas, wenn man diese stille Online-Abstimmung hat. Insofern bin ich auch selbst immer hin- und hergerissen, was jetzt die bessere Abstimmungsmethode ist.
Du hast erwähnt, dass jemand, der etwas Lustiges oder Rührendes gemacht hat, gewonnen hat – sind das die Erfolgskriterien im Wettbewerb?
Man muss nicht nur lustig sein beim Reporter Slam, aber am Ende war es meist der Unterhaltungswert, der beim Jahresfinale gezählt hat. Und es muss auch nicht der gesamte Vortrag lustig sein, das ist vielleicht anders als bei Comedy, wo man idealerweise alle 20 oder 30 Sekunden die nächste Pointe hat. Man kann bei uns auch eine Geschichte entwickeln und dann an den richtigen Stellen eine Pointe setzen, ohne das zu überfrachten.
Wie viele Shows macht ihr übers Jahr?
Unser Jahresplan sieht für die nächsten Jahre vor, dass wir sechs Slams machen, davon vier in Deutschland und zwei im Ausland, idealerweise regional verteilt, also einmal Nord, Süd, Ost und West. So hätte also jeder die Chance, unseren Reporter Slam zu sehen, ohne weit reisen zu müssen. Der siebte Slam ist dann immer das Jahresfinale in Berlin, meistens im Januar.
Gibt es auch Re-Lives, dass man sich also eure Show bei YouTube im Nachhinein angucken kann?
Ja, zum Beispiel kann man sich das letzte Jahresfinale noch angucken, in sehr guter Qualität übrigens, weil es von dem TV-Sender Alex Berlin übertragen wurde. Man findet auch die früheren Jahresfinale noch im Netz. Und wenn einem das zu lang ist mit zwei Stunden, dann kann man sich auch nur die einzelnen Siegervorträge anschauen. Die sind ja in der Regel nur zehn Minuten lang. Aber grundsätzlich wollen wir die Leute natürlich in den Saal locken, das unmittelbare Live-Erlebnis ist ja gerade die Stärke des Live-Journalismus.

In der Show selbst soll alles locker wirken – aber im Vorfeld kommt’s darauf an, alles penibel vorzubereiten. Foto: Jörg Farys
Wie hoch sind die Eintrittspreise für eure Veranstaltungen?
Das kommt aufs Format an. Bei den Slams liegen wir meist zwischen 10 und 15 Euro.
Seid ihr eigentlich die einzige Firma, die solche Formate anbietet in Deutschland – oder habt ihr auch Wettbewerber?
Am Anfang hatten wir Wettbewerber in Berlin. Die haben eine Show namens „Journalism on Stage“ gemacht. Die haben das relativ kurz nach unseren Reporter Slams begonnen, waren auch in größeren Locations, hatten aber nicht den Wettbewerbscharakter, sondern einfach nur mehrere Reporter, die nacheinander von ihren Recherchen erzählt haben und dann vom Publikum befragt werden konnten. Die haben aber dann nach ein paar Ausgaben aufgegeben, aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel ist einer ins Ausland gezogen. Heute sind wir nach unserem Wissen die einzige Agentur in Deutschland mit diesen Formaten.
Wenn du nach vorne guckst für diese Art von Veranstaltungen, wie siehst du da die Zukunft? Besteht in Deutschland auch so ein Potenzial wie in anderen Ländern, dass der Live-Journalismus eine verbreitete Abendalternative wird?
Ja, das ist unsere Hoffnung und unsere Vision, dass wir damit auch noch viel größere Säle füllen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen in aller Welt einfach gute Geschichten lieben. Das war schon immer so und wird immer so sein. Und das, was die Franzosen vormachen oder die Finnen in ihrem großen Nationaltheater, das sollte doch auch in Deutschland möglich sein.

Musik gehört dazu: Bei den Reporter Slams lockern Bommi und Brummi zwischendurch die Show mit Liedern auf – natürlich zu Journalismus-Themen. Foto: Vic Harster
Das Interview führte Stefan Brunn.