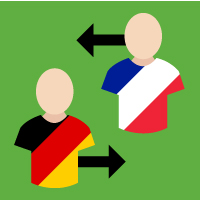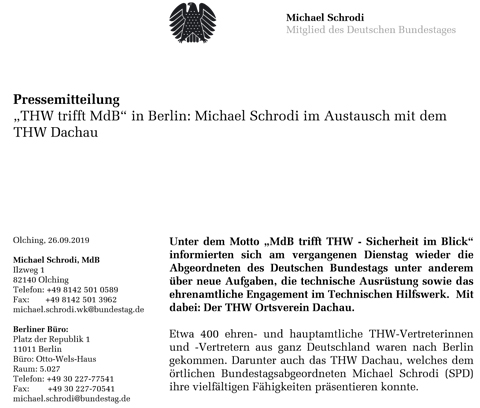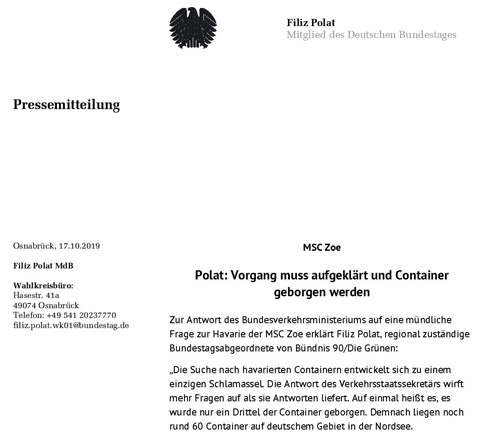Psychologische Fachbegriffe finden immer häufiger Eingang in unsere Alltagssprache: Überall ist von Trauma, Triggern, Narzist:innen und Co. die Rede. Wir zeigen, warum der inflationäre Gebrauch dieser Wörter nicht nur nervig, sondern auch problematisch ist.
Von Katrin Liffers
„Ich hab’ echt ein Trauma von der Mathestunde heute!“
„Mein Ex-Freund ist ein richtiger Narzisst!“
„Das Wetter macht mich richtig depressiv!“
Sind Ihnen solche Formulierungen auch schon zu Ohren gekommen? Immer mehr Begriffe aus der Psychologie haben mittlerweile Eingang in unseren Alltag gefunden. Sei es in Gesprächen mit Freund:innen, in Talkshows oder Videos.
Auf den ersten Blick ist das natürlich ein schönes Phänomen. Es kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass wir uns immer mehr mit unserer Psyche auseinandersetzen, unsere Gefühle hinterfragen und sie nicht verdrängen. Und weil psychische Krankheiten immer weniger tabuisiert werden, trauen wir uns auch häufiger, offen über dieses Thema zu sprechen.
Schwierig ist allerdings, dass diese Begriffe in vielen Fällen gar nicht auf den medizinischen Aspekt verweisen, den sie eigentlich bezeichnen. Viel mehr stellt das Phänomen eine typische Konsequenz der Aufmerksamkeitsökonomie dar: In einer Welt, in der alles schneller, besser, lauter sein muss, reicht es nicht mehr aus, Sachverhalte realistisch darzustellen. Stattdessen braucht es starke Übertreibungen, um wirklich wahrgenommen zu werden. Und deshalb nervt einen das Verhalten der besten Freundin dann nicht mehr – es triggert einen.
Das Problematische daran: Der inflationäre Gebrauch der Fachbegriffe rückt ihre tatsächliche Bedeutung in den Hintergrund. Wer kann unterscheiden, ob jemand eine echte Panikattacke hatte oder sich einfach nur stark aufgeregt hat? Und ist die Partnerin wirklich toxisch oder hat sie vielleicht einfach nur was Blödes gemacht? Den tatsächlich Betroffenen schwindet so immer mehr die Möglichkeit, ihre Krankheit sichtbar zu machen. Und damit auch die Möglichkeit, dass sie ernst genommen werden und angemessene Hilfe erhalten. Denn wenn jeder Zweite traumatisiert ist, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein.
Fazit: Dass Begriffe ihre ursprünglichen Anwendungsbereiche verlassen, ist kein neues Phänomen und nicht per se problematisch: In vielen Fällen gewinnt unsere Sprache dadurch. Aber immer dann, wenn Gefühle oder Probleme durch inflationären Gebrauch entwertet werden, lohnt es sich, noch mal nachzudenken. Dann war der Einkauf nach den Feiertagen vielleicht einfach nur anstrengend und nervig, aber eben nicht traumatisch.