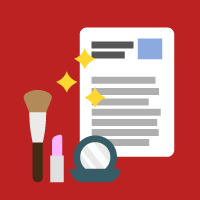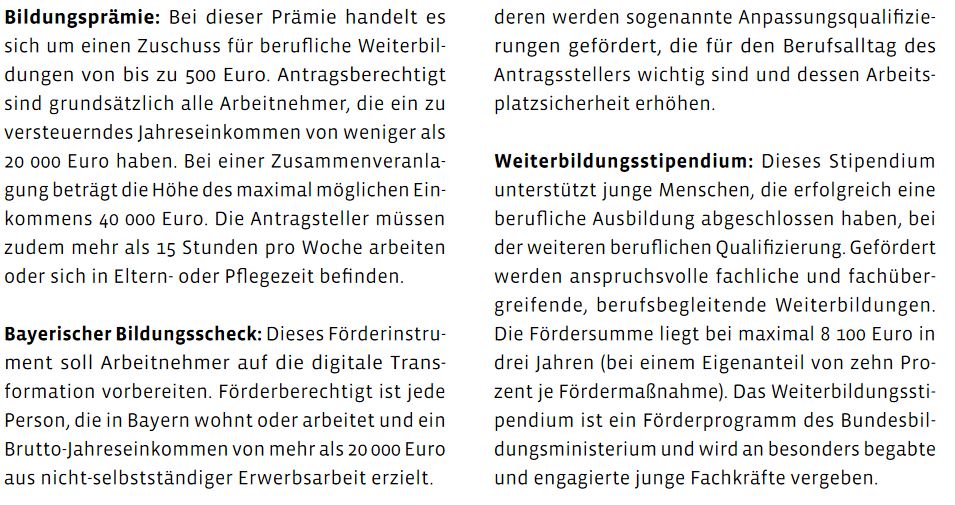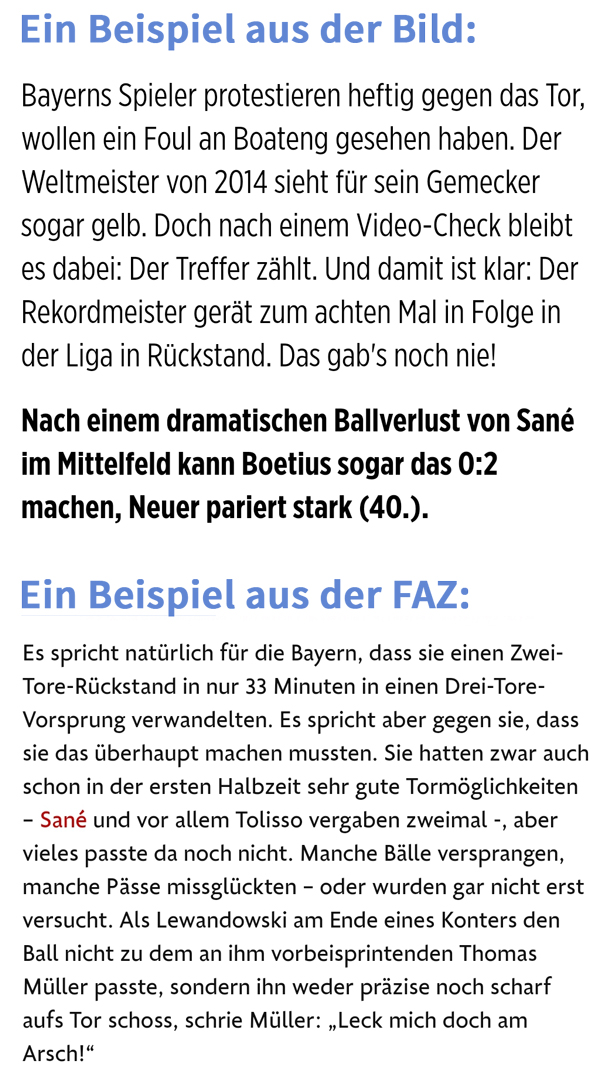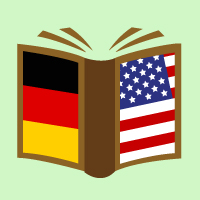 Wie kann es sein, dass man oft fremdsprachliche Fachbücher leichter liest als deutsche? Gerade Bücher aus den USA versteht man schneller als solche in der eigenen Muttersprache. Fünf Thesen dazu nageln wir mal an unseren virtuellen Bücherschrank. 😉
Wie kann es sein, dass man oft fremdsprachliche Fachbücher leichter liest als deutsche? Gerade Bücher aus den USA versteht man schneller als solche in der eigenen Muttersprache. Fünf Thesen dazu nageln wir mal an unseren virtuellen Bücherschrank. 😉
Von Stefan Brunn
1. These: Wir haben die längeren Wörter!
Es ist unter Sprachwissenschaftler*innen unumstritten, dass man Texte mit kürzeren Wörtern leichter liest als solche mit längeren. Anders als etwa im Englischen kann man im Deutschen Wörter fast beliebig zusammenfügen, nicht zum Vorteil der leichten Lektüre. Ich sage nur: Pflanzenschutzmittelrückstandshöchstgehaltsüberschreitungen!
2. These: Wir haben die komplizierteren Sätze!
In anderen Sprachen stehen Subjekt und Prädikat immer zusammen. Im Deutschen können wir sie beliebig weit auseinanderziehen – und wenn am Ende das auflösende Verb folgt, weiß man oft schon nicht mehr, was vorn im Satz stand: „Am Nachmittag wird die Beamtin den Konferenzraum für die Abgeordneten des Parlaments für mindestens zwei Stunden …“ Ja, was nun? Aufschließen? Abschließen? Durchlüften? Im Englischen wüsste man es schon lange!
3. These: Wir haben mehr Fremdwörter!
Unsere Sätze enthalten schlicht mehr Fremdwörter als englische. Während die angelsächsischen Länder gefühlt alle 50 Jahre mal ein deutsches Wort einbürgern, tun wir das umgekehrt gefühlt alle 5 Tage. Das bereichert zwar unsere Sprache. Aber das macht es auch schwerer, alles zu verstehen. Da muss man schon ganz schön woke sein!
4. These: Wir treten weniger für verständliche Texte ein!
Besonders in den USA verfolgt man das Ziel, dass sich alle verständlich ausdrücken, viel vehementer. Der „plain language act“ von Barack Obama hat dieses Ziel auch formell verankert: Es gibt Behörden, die prüfen, ob die Texte anderer Behörden bürgerfreundlich formuliert sind. Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf! In Deutschland setzt man hingegen nicht auf eine verbindlich einfache Sprache für alle, sondern auf die sogenannte „Leichte Sprache“ für eine eng umrissene Zielgruppe – und nur für ganz wenige Texte.
5. These: Wir haben Angst, selbst zu einfach zu schreiben!
Viel mehr als alle vorgenannten Punkte schlägt aber etwas anderes durch: In Deutschland schrecken die Leute davor zurück, sich einfach auszudrücken. Dahinter stehen diverse Motive, die zu diskutieren hier zu weit führen würde. Aber eines wollen wir hier doch geraderücken: Wer schwer verständliche Texte schreibt, den hält man eher nicht für intelligent. Diese Erkenntnis aus der Psychologie stammt allerdings – Sie haben es sicher vermutet – aus den USA. Daniel Oppenheimer hat dafür einen alternativen Nobelpreis gewonnen. Seine Forschungsarbeit (PDF) ist übrigens sehr witzig und liest sich ziemlich leicht …