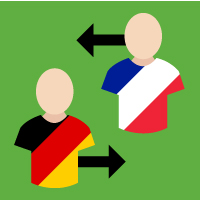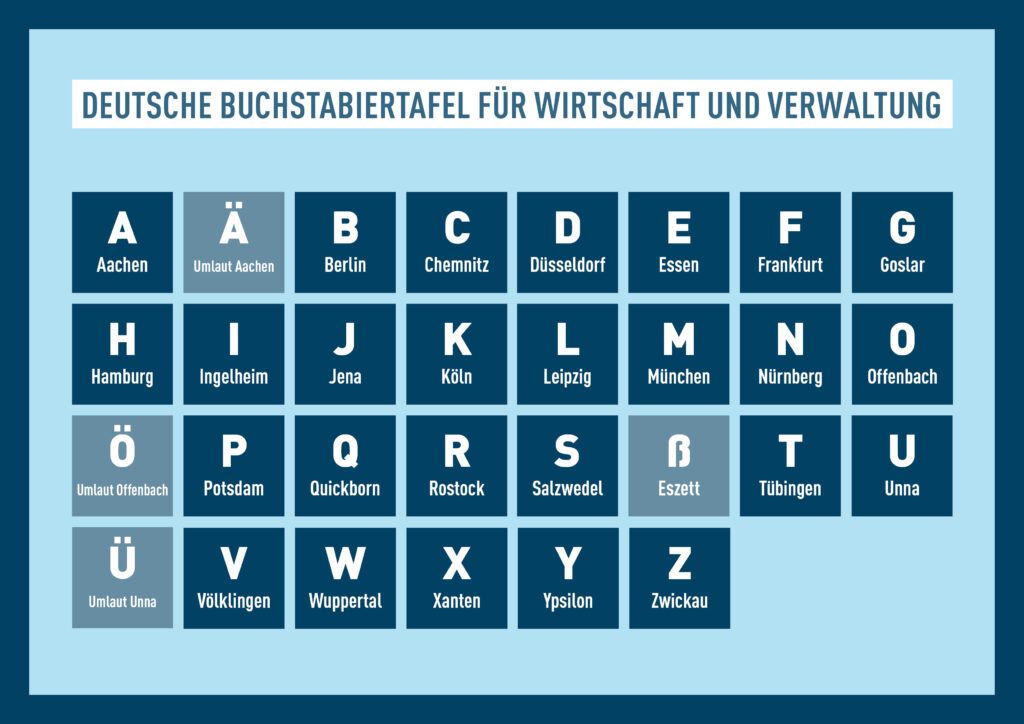Lange Texte auf Webseiten schrecken ab. Im Internet unternimmt man deshalb einiges, um Texte kürzer und übersichtlicher zu gestalten. Neben sogenannten Akkordeons werden dazu auch Cluster-Techniken wie das Schichtkuchen-Prinzip oder der Lazy-Load verwendet. Wir zeigen sie im Bild!
Von Hannah Molderings
Akkordeons

Akkordeons (auch Spoiler genannt) sind dazu gedacht, Informationen hinter einer Schaltfläche zu verstecken – so lange, bis Nutzer*innen sich entscheiden, diesen Text auszuklappen und lesen zu wollen. Durch sprechende Überschriften gibt man einen guten Überblick über die Themenfelder, überfrachtet die Seite aber nicht. Es muss nicht endlos gescrollt und gelesen werden – gerade für kleinere Endgeräte ein großes Plus. Nachteile: etwas mehr Arbeit und angeblich schlechtere Position der weggeklappten Texte in Suchmaschinen.
Tabs

Tabs funktionieren ganz ähnlich wie Akkordeons. Der Unterschied: Hier werden die Oberthemen nebeneinander statt untereinander angeordnet. Im Grunde sind auch die Vorteile die gleichen: leicht konsumierbare Inhalte, mundgerecht vorbereitet. Nachteil: Auf schmalen Geräten passen die einzelnen Tabs oft nicht nebeneinander und rutschen dann in die nächste Zeile – einige Plugins wandeln die Tabs aber auf mobilen Geräten in Akkordeons um.
Infokästen

Durch Infokästen werden zwar keine Inhalte versteckt – sie helfen trotzdem dabei, Informationen leichter konsumierbar zu machen. Der Clou: Bestimmte Infos werden gezielt aus dem Haupttext herausgezogen und ausgelagert. Der Kasten hebt diese Infos gestalterisch vom Rest des Textes ab. Infokästen eignen sich also vor allem für Inhalte, die inhaltlich besser nicht Teil des Haupttextes sein oder besonders hervorgehoben werden sollen.
Schichtkuchen-Prinzip

Wenn Sie den Zeilenhacker fleißig verfolgen, sind Ihnen diese bunten Kästen sicher schon aufgefallen. Häufig bauen wir unsere Artikel nach dem sogenannten Schichtkuchen-Prinzip auf. Das heißt: Infos werden in kleinere Bereiche aufgeteilt und dann Schicht für Schicht präsentiert. Häufig wird dieses Prinzip auch für FAQ-Seiten genutzt. Der Vorteil dieser kleinen Info-Häppchen: Jede/r kann sich die Infos rauspicken, die er/sie braucht. Wichtig: Das Schichtkuchen-Prinzip bringt nur einen Vorteil, wenn man sprechende Überschriften nutzt und sich auf kurze Texte beschränkt.
Lazy-Load
Leider mussten wir hier einen Screenshot aus rechtlichen Gründen löschen. Zu sehen war die Seite von Tag24 mit ihrem Lazy-Load-Bereich, bei dem unten automatisch immer wieder neue Beiträge erscheinen.
Auf Nachrichtenseiten wie dieser findet man diese Technik recht häufig. Zunächst lädt die Seite nur einen Teil der Inhalte. Scrollt man dann herunter, bilden sich weitere Inhalte aus. Das mag zunächst verwirrend erscheinen: Man glaubt, dass man bereits alle Inhalte überblicken kann und plötzlich wird die Seite immer länger und scheint gar kein Ende zu haben. Man simuliert also, dass das Ende der Seite schnell erreicht ist. Und man präsentiert seine Informationen in kleinen Portionen. Haben die Leser*innen den ersten Bereich gelesen, können sie selbst entscheiden, ob sie auch die nächsten Inhalte noch lesen wollen. Genervt vom Lazy-Load sind allerdings Leute, die auf einer Seite auch gern mal ein Ende erreichen. 😉