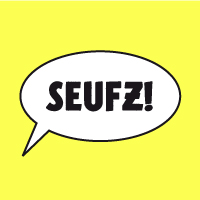 Erst tauchten sie in Märchen auf, dann in Comics, später in Foren und Chats, inzwischen sind sie aus Whatsapp und Co. nicht mehr wegzudenken: kreisch! Aber wie heißen solche Wörter eigentlich? In unserem 11-Fragen-Quiz lernt man das und viel mehr.
Erst tauchten sie in Märchen auf, dann in Comics, später in Foren und Chats, inzwischen sind sie aus Whatsapp und Co. nicht mehr wegzudenken: kreisch! Aber wie heißen solche Wörter eigentlich? In unserem 11-Fragen-Quiz lernt man das und viel mehr.
Von Stefan Brunn
Quiz-Zusammenfassung
0 von 10 Fragen beantwortet
Fragen:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Informationen
.
Sie haben das Quiz schon einmal absolviert. Daher können sie es nicht erneut starten.
Quiz wird geladen...
Sie müssen sich einloggen oder registrieren um das Quiz zu starten.
Sie müssen erst folgende Quiz beenden um dieses Quiz starten zu können:
Ergebnis
Zeit ist abgelaufen
Sie haben 0 von 0 Punkten erreicht (0)
Kategorien
- Nicht kategorisiert 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Beantwortet
- Vorgemerkt
-
Frage 1 von 10
1. Frage
Was genau steckt grammatikalisch hinter diesen Wörtern?
Korrekt
Es geht darum, dass man die Infinitivendung weglässt: stöhn anstelle stöhnen, ächz anstelle ächzen usw.
Inkorrekt
Es geht darum, dass man die Infinitivendung weglässt: stöhn anstelle stöhnen, ächz anstelle ächzen usw.
-
Frage 2 von 10
2. Frage
Wie nennen Germanisten diese Form?
Korrekt
Inflektiv. Es gibt aber noch mehr Namen für diese Form des Verbs – aber dazu gleich mehr …
Inkorrekt
Inflektiv. Es gibt aber noch mehr Namen für diese Form des Verbs – aber dazu gleich mehr …
-
Frage 3 von 10
3. Frage
Wie nannten Comic-Fans diese Verbform vor der Erfindung des Begriffs „Inflektiv“?
Korrekt
Erikativ hieß diese Form, benannt nach der bekannten Disney-Übersetzerin Erika Fuchs.
Inkorrekt
Erikativ hieß diese Form, benannt nach der bekannten Disney-Übersetzerin Erika Fuchs.
-
Frage 4 von 10
4. Frage
Welches Wort verwenden Germanisten außerdem für den Inflektiv?
Korrekt
Lexeminterjektion. Ein Lexem ist die kleinste Einheit, die die Wortbedeutung anbetrifft. Und eine Interjektion ist ein Ausruf. So bilden beide zusammen die kürzeste Ausruf-Einheit eines Wortes. Andere sprechen übrigens von „Rumpfwörtern“ oder „deverbativen Interjektionen“. Es existiert insgesamt mindestens ein halbes Dutzend Namen für die gleiche grammatikalische Form.
Inkorrekt
Lexeminterjektion. Ein Lexem ist die kleinste Einheit, die die Wortbedeutung anbetrifft. Und eine Interjektion ist ein Ausruf. So bilden beide zusammen die kürzeste Ausruf-Einheit eines Wortes. Andere sprechen übrigens von „Rumpfwörtern“ oder „deverbativen Interjektionen“. Es existiert insgesamt mindestens ein halbes Dutzend Namen für die gleiche grammatikalische Form.
-
Frage 5 von 10
5. Frage
Wann wurde der germanistische Fachbegriff „Inflektiv“ erfunden?
Korrekt
Der Begriff wurde 1998 von dem Germanisten Oliver Teuber eingeführt.
Inkorrekt
Der Begriff wurde 1998 von dem Germanisten Oliver Teuber eingeführt.
-
Frage 6 von 10
6. Frage
Die Innsbrucker Sprachwissenschaftlerin Susanne Pauer hat einmal die Inflektive in Micky-Maus-Heften gezählt. Ihrer Analyse zufolge lassen sich Inflektive in vier Gruppen einteilen. Welche ist wohl die häufigste?
Korrekt
Die Gruppe der Töne bezeichnenden Verbformen liegt statistisch klar vorn, gefolgt von der dritten Gruppe der geräuschvolle Tätigkeiten bezeichnenden Verbformen.
Inkorrekt
Die Gruppe der Töne bezeichnenden Verbformen liegt statistisch klar vorn, gefolgt von der dritten Gruppe der geräuschvolle Tätigkeiten bezeichnenden Verbformen.
-
Frage 7 von 10
7. Frage
Durch welches Zeichen wird der Inflektiv in Chats und Foren symbolisiert?
Korrekt
*seufz*
Inkorrekt
*seufz*
-
Frage 8 von 10
8. Frage
Eine österreichische Band integrierte 1996 einen Inflektiv in ihr Lied „Küss die Hand, schöne Frau!“ Wie hieß diese Band?
Korrekt
Erste Allgemeine Verunsicherung. In dem Lied „Küss die Hand, schöne Frau!“ heißt die entsprechende Verszeile wie folgt: „Grübel, grübel und studier / Warum fahr‘ ma net zu dir?“
Inkorrekt
Erste Allgemeine Verunsicherung. In dem Lied „Küss die Hand, schöne Frau!“ heißt die entsprechende Verszeile wie folgt: „Grübel, grübel und studier / Warum fahr‘ ma net zu dir?“
-
Frage 9 von 10
9. Frage
Der Schriftsteller Max Goldt hat 2015 ein Buch mit einem Inflektiv benannt. Wie heißt das Buch?
Korrekt
Räusper. Der Untertitel lautet übrigens „Comic-Skript in Dramensatz“.
Inkorrekt
Räusper. Der Untertitel lautet übrigens „Comic-Skript in Dramensatz“.
-
Frage 10 von 10
10. Frage
Ein ehemaliger Fernsehmoderator prägte eine ganz besondere Spielart von Inflektiven: Ausdrücke ekliger oder sexueller Geräusche und Handlungen, etwa *lechz* und *keuch*. Wer war das?
Korrekt
Herbert Feuerstein war es, als Chefredakteur des Magazins MAD. Das war ja wohl nicht schwer! *grins*
Inkorrekt
Herbert Feuerstein war es, als Chefredakteur des Magazins MAD. Das war ja wohl nicht schwer! *grins*















