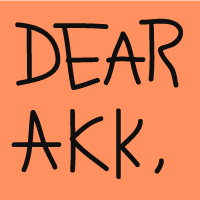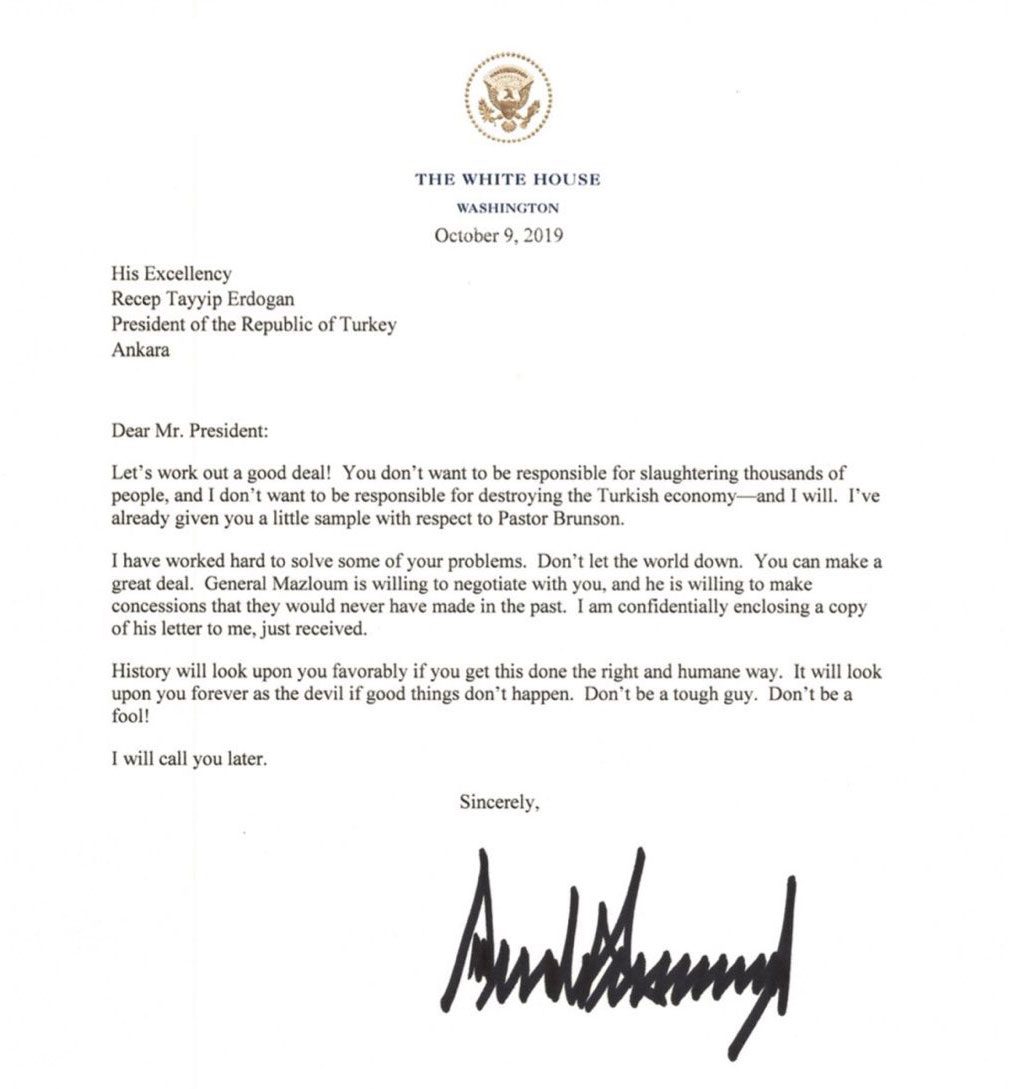Wer beim Schreiben bisher lange nach bestimmten Sonderzeichen gesucht hat, kann sich das künftig sparen: Auf www.zeichen.tv kann man sich solche Zeichen blitzschnell kopieren und in eigene Texte einfügen. Wir erläutern, wie das funktioniert.
Von Maren Tönisen
Auf der Seite www.zeichen.tv kann man nach gewünschten Sonderzeichen suchen. Gibt man in das Suchfeld zum Beispiel „Telefon“ ein, bekommt man ein passendes Telefonzeichen geliefert. Dann muss man auf das Zeichen klicken und es auf der Folgeseite markieren und kopieren – schon ist es im Zwischenspeicher. Genial!
Hat man das Zeichen einmal in einen Word-Text gesetzt, verändert es sich auch dann nicht, wenn man die Schriftart des Word-Dokumentes verändert. Eingefügt wird das Zeichen immer in der Schriftart „Segoe Ul Symbol“. Man kann das Zeichen auch in die eigene Schriftart umwandeln – aber natürlich nur, wenn dieses Zeichen im eigenen Zeichensatz enthalten ist. Ist es nicht enthalten, bleibt’s einfach bei der Segoe.
Zeichen gibt’s übrigens nicht nur für die üblichen Verdächtigen wie ≠ oder ✘ oder ✔, sondern auch fürs ✆, für ein ✈ und für ein ♥. Sogar 🙉 und 🐷 findet man …
Die Suchmaschine der Seite funktioniert prima. Allerdings gibt’s einfach manche populären Zeichen nicht, zum Beispiel einen Fußball. Aber selbst wenn es auf der Seite nicht alle Sonderzeichen gibt: Wir finden www.zeichen.tv – ein Projekt des Hamburger Medien- und Kommunikationsdesigners Martin Dellert – eine gute Idee. Deswegen dachten wir, darüber muss man mal was ✍.




 Die Klickrate lag sogar mehr als zehn Mal so hoch, und darauf sind wir ein bisschen stolz. Aber nicht jede Ausgabe des „Zeilenhackers“ ist gleich erfolgreich. Wir konkurrieren mit jeder Ausgabe ein bisschen mit uns selbst. Dafür brauchen wir Ihre Daten. Aber erstens nur eine einzige E-Mail-Adresse und zweitens nur für ganz positive Zwecke, versprochen!
Die Klickrate lag sogar mehr als zehn Mal so hoch, und darauf sind wir ein bisschen stolz. Aber nicht jede Ausgabe des „Zeilenhackers“ ist gleich erfolgreich. Wir konkurrieren mit jeder Ausgabe ein bisschen mit uns selbst. Dafür brauchen wir Ihre Daten. Aber erstens nur eine einzige E-Mail-Adresse und zweitens nur für ganz positive Zwecke, versprochen!