 Das Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache nimmt in diesen Tagen seine Arbeit auf: Es sammelt Informationen zu deutschen Wörtern. Wir haben kurz vor der Auftaktveranstaltung in Berlin mit Alexander Geyken, einem der wissenschaftlichen Leiter, über den praktischen Nutzen des Dienstes gesprochen.
Das Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache nimmt in diesen Tagen seine Arbeit auf: Es sammelt Informationen zu deutschen Wörtern. Wir haben kurz vor der Auftaktveranstaltung in Berlin mit Alexander Geyken, einem der wissenschaftlichen Leiter, über den praktischen Nutzen des Dienstes gesprochen.
Wer sich für die Geschichte der deutschen Sprache interessiert, konnte und kann dazu bis jetzt im „Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache“ (DWDS) recherchieren: Auf dessen Internetseite www.dwds.de erfährt man Hintergründe zu einzelnen Wörtern. Die Infos beruhen auf dem Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache und auf Teilen des Großen Wörterbuchs der deutschen Sprache. Zur Seite gehören praktischerweise auch Wortverlaufskurven, die anzeigen, wie häufig ein Wort im Zeitverlauf in Publikationen benutzt wurde.
Das DWDS ist ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es wird in diesen Tagen durch das Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache (ZDL) erweitert. Ziel dieses Instituts ist es, ein neues, digitales Wörterbuch zu entwickeln und zu betreiben, das den deutschen Wortschatz und seine Veränderungen noch umfassender beschreibt als das DWDS. Zeilenhacker-Redakteurin Maren Tönisen hatte vorab die Gelegenheit, mit Alexander Geyken, einem der wissenschaftlichen Leiter des ZDL, zu sprechen.
Herr Geyken, was ist die Aufgabe des neuen Zentrums für digitale Lexikographie der deutschen Sprache?
Das ZDL ist eigentlich das „Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache“, also das DWDS – nur in viel größer. Alles, was wir beim DWDS im Angebot haben – Wörterbücher, Textkorpora und statistische Auswertungen – soll ausgebaut und verbessert werden, sowohl von der Menge als auch von der historischen Tiefe her.
Wieso?
Die Textkorpora des DWDS setzen sich zu über 90 Prozent aus Zeitungsartikeln zusammen. Unsere Sprache wird also nur unzureichend abgebildet. Bei Belletristik, Sachbüchern und Ratgebern verfügt das DWDS nur über kleinere Sammlungen, die für statistische Auswertungszwecke nicht ausreichen.
Welche weiteren Ziele verfolgen Sie mit dem ZDL?
Wir planen zum Beispiel die Einrichtung einer Facebook-Seite und eines Blogs. Dort werden unsere Lexikografen über interessante Wörter schreiben, die dem Sprachwandel unterliegen. Die Bedeutung des Wortes „Ehe“ zum Beispiel: Früher ist damit lediglich die Ehe zwischen Frauen und Männern bezeichnet worden. Heute kann damit auch eine gleichgeschlechtliche Ehe gemeint sein. Das Wort „Ehe“ muss also anders beschrieben werden als noch vor einigen Jahren. Wir befassen uns aber sowohl mit der Gegenwart des Wortes als auch mit seiner Wortgeschichte.
Wird die bestehende DWDS-Webseite ausgebaut werden oder wird es eine neue ZDL-Webseite geben?
Es wird eine neue Webseite geben. Sie wird wohl gegen Ende des Jahres veröffentlicht.
Wie viele Wörter werden am Ende auf der ZDL-Webseite zu lesen sein?
Das Wörterbuch soll, wenn es fertig ist, etwa eine Million Wörter umfassen.
Woher stammen die Wörter, die ins neue digitale Wörterbuch kommen?
Entweder geschieht das halbautomatisch über eine morphologische Textanalyse, die Wörter aus bestehenden Texten zieht, sie zerlegt und alles Unbekannte herausfiltert. Die unbekannten Wörter landen dann auf dem Tisch unserer Lexikografen. Sie schauen, ob es sich eventuell nur um einen Eigennamen handelt oder ob doch etwas Interessantes dahintersteckt. Oft fallen uns Wörter aber auch selbst auf – oder aber anderen. Die Stärke des neuen Zentrums wird es auch sein, dass wir uns mehr Tipps von außen holen können. Das ZDL fragt sich: Wie können Personen wie Sprachprofis oder Sprachliebhaber etwas zum Wörterbuch beitragen? Ein Beispiel: Im Duden ist „Bedarfe“ als fachsprachlich eingetragen. Aber in welchen Bereichen wird das Wort verwendet und seit wann gibt es das Wort im Plural eigentlich?
Kann man Sie also einfach anrufen und Ihnen Hinweise zu einzelnen Wörtern geben?
Nein. Aber wir bieten ein Webformular mit der Möglichkeit, uns Anregungen zu schicken. Diese werden an die jeweiligen Expertinnen und Experten weitergeleitet und von ihnen bearbeitet.
An wen richtet sich das ZDL?
Das ZDL richtet sich zunächst an alle Personen, die professionell mit Sprache umgehen oder Sprachwissen vermitteln – also etwa an Wissenschaftler, Literaturübersetzer, Journalisten und Lehrer. Darüber hinaus will es aber für alle zugänglich und offen sein, die sich für die deutsche Sprache interessieren.
Das ZDL
Das ZDL wird getragen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz sowie der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Darüber hinaus hat das ZDL zwei Kooperationspartner: das Institut für Deutsche Sprache sowie das Goethe-Institut. Gefördert wird das ZDL für acht Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Vorgestellt wird das ZDL bei einer Auftaktveranstaltung am Dienstag, 29. Januar, 14 Uhr. Jeder, der sich für Sprache interessiert, ist an diesem Tag eingeladen, zum Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, in Berlin zu kommen. Anmeldungen bis Mittwoch, 23. Januar, erbeten: https://www2.bbaw.de/anmeldung-zdl





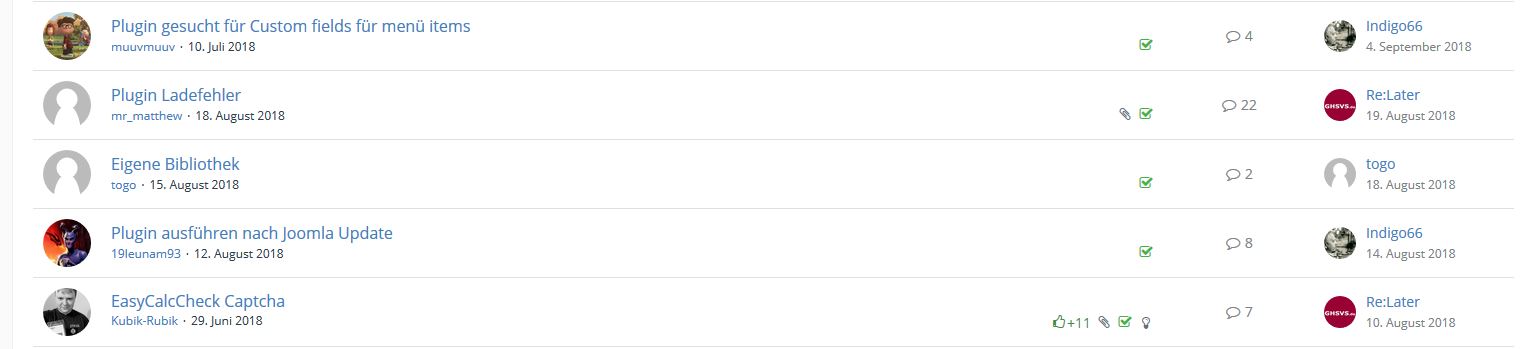
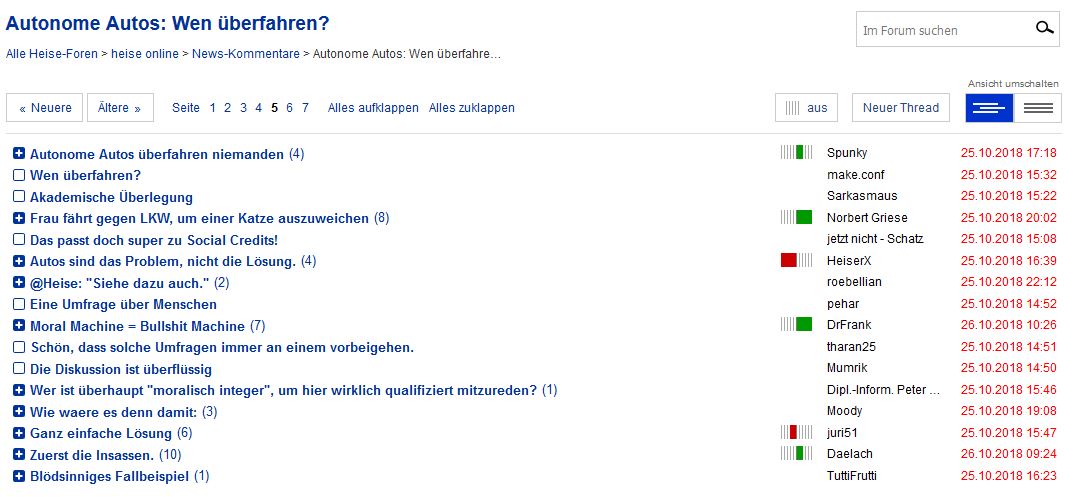
 Es nervt, wenn Word einen dauernd so korrigiert, dass man es wieder zurücknehmen muss! Am häufigsten passiert das, wenn Word hinter einem Punkt ein Satzende vermutet und den folgenden Buchstaben groß schreibt. Man kann das aber ganz leicht abstellen …
Es nervt, wenn Word einen dauernd so korrigiert, dass man es wieder zurücknehmen muss! Am häufigsten passiert das, wenn Word hinter einem Punkt ein Satzende vermutet und den folgenden Buchstaben groß schreibt. Man kann das aber ganz leicht abstellen …

 Qualitätsjournalismus zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wiesbaden: Springer VS, 2018. 340 Seiten; 39,99 Euro. ISBN 978-3-658-22089-1.
Qualitätsjournalismus zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wiesbaden: Springer VS, 2018. 340 Seiten; 39,99 Euro. ISBN 978-3-658-22089-1.


 1740 hatte der Basler Professor Johann Jakob Spreng begonnen, ein handschriftliches Wörterbuch zu verfassen, sein „Allgemeines deutsches Glossar“. 20 Bände sind es bis zu seinem Tod geworden – übrigens vor genau 250 Jahren, mit fast 100.000 Einträgen. Gedruckt wurde es jedoch nie, weil sich nicht genug Käufer fanden.
1740 hatte der Basler Professor Johann Jakob Spreng begonnen, ein handschriftliches Wörterbuch zu verfassen, sein „Allgemeines deutsches Glossar“. 20 Bände sind es bis zu seinem Tod geworden – übrigens vor genau 250 Jahren, mit fast 100.000 Einträgen. Gedruckt wurde es jedoch nie, weil sich nicht genug Käufer fanden.

