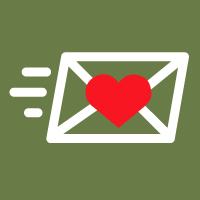Herr Müller, kommst Du mal? Saskia, könnten Sie mal kurz? Was für Außenstehende erheiternd rüberkommt, wirkt für die Angesprochenen manchmal ziemlich herabsetzend.
Von Stefan Brunn
Die Sache hat zwei Seiten: Einerseits können diese Mischformen des Duzens/Siezens ein Kompromiss sein. Ein meist unausgesprochenes Agreement zwischen zwei Menschen, deren Beziehung eben ungeklärt zwischen Du und Sie steht. Andererseits werden diese Formen oft nicht symmetrisch zwischen Gleichberechtigten gewählt, sondern einseitig von oben nach unten – darauf deutet auch der konkurrierende Name „Kassiererinnen-Du“ hin.
Wir wollen weder das Hamburger Sie noch das Münchner Du pauschal verurteilen. Wir wollen aber, dass Sie beide Formen kennen und sensibel damit umgehen.
Das Hamburger Sie
Beim Hamburger Sie nennt man jemanden beim Vornamen, siezt ihn aber: „Werner, reichen Sie mir mal den Vertrag?“ Diese Art des Siezens ist nicht nur in Hamburg verbreitet, wie der Name nahelegen könnte. Das Hamburger Sie ist überall dort zu hören, wo nicht ganz klar ist, ob man duzen oder siezen sollte. Es kann wirklich ein für beide Seiten smarter Kompromiss ein. Bei erwachsenen Schüler*innen zum Beispiel oder überhaupt zwischen Generationen. Dass es oft bei Schüler*innen verwendet wird, deutet aber auch darauf hin, dass es herabsetzend wirken kann. Ein Indiz ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass die angesprochene Person auf gleiche Weise antwortet. Das gilt übrigens nicht nur bezüglich des Alters, sondern mehr noch, wenn es um Hierarchien geht oder um das Verhältnis von Auftraggebern zu Auftragnehmern, von Kunden zu Dienstleistern etc.
Das Münchner Du
Beim Münchner Du nennt man umgekehrt jemanden beim Nachnamen, duzt ihn aber: „Frau Mustermann, kannst Du mal den Kuchen holen?“ Diese Form wird auch als „Kassiererinnen-Du“ bezeichnet. Das deutet schon an, dass das Münchner Du durchaus als herabwürdigend empfunden werden kann. Anders als beim Hamburger Sie duzt man hier ja tatsächlich jemanden. Dafür aber ist im Deutschen eigentlich immer eine vorherige Zustimmung des anderen erforderlich – wenn man nicht ohnehin sehr vertraut ist oder sogar sicher weiß, dass der oder die Angesprochene diese Anrede als charmant oder ironisch auffasst.
Warum die beiden Formen nach Hamburg und München benannt wurden, haben wir bis jetzt nicht herausfinden können. Sehr geehrte Leserschaft, wenn Du das weißt, hilf uns bitte! 😉





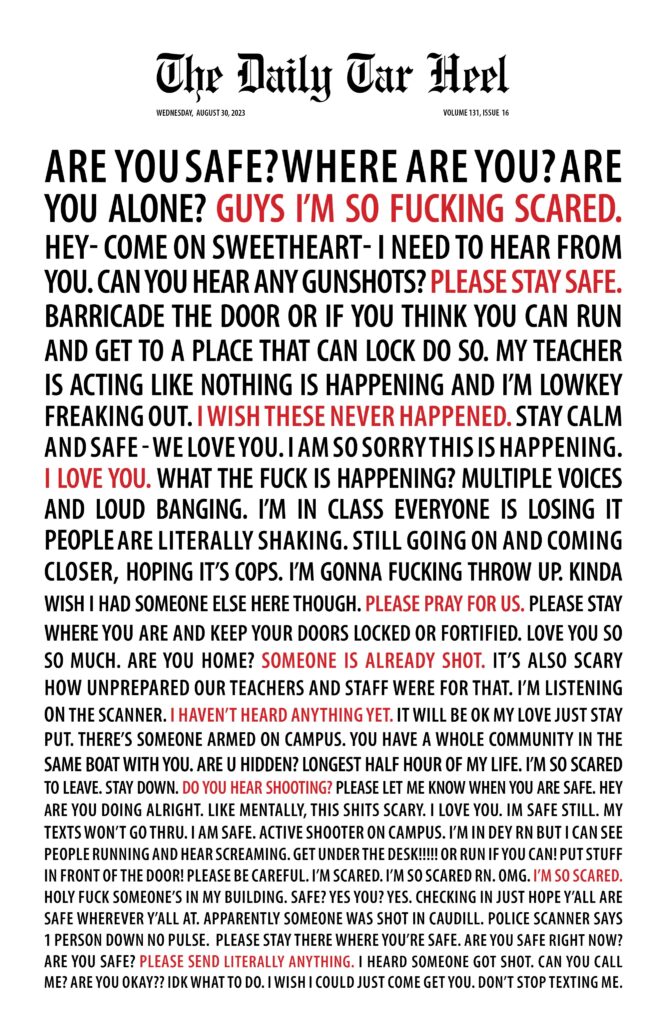

 Auch Sprachen vergessen. Zum Beispiel gehen über die Jahrhunderte Ausdrücke verloren, weil sie zu selten benutzt werden, die Pfauenehe etwa. Einige davon können Sie mit unserem kleinen Quiz wiederentdecken. Ausgedacht haben sich die Fragen die Basler Germanisten Suzanne de Roche und Heinrich Löffler.
Auch Sprachen vergessen. Zum Beispiel gehen über die Jahrhunderte Ausdrücke verloren, weil sie zu selten benutzt werden, die Pfauenehe etwa. Einige davon können Sie mit unserem kleinen Quiz wiederentdecken. Ausgedacht haben sich die Fragen die Basler Germanisten Suzanne de Roche und Heinrich Löffler.