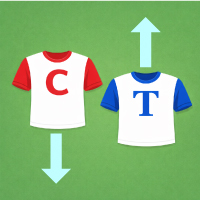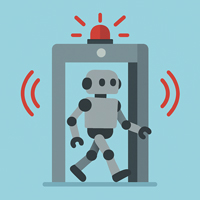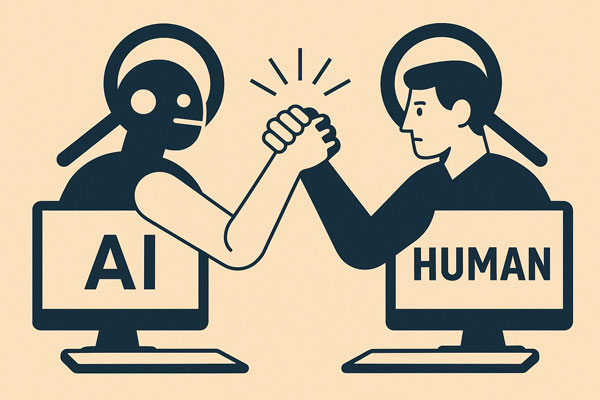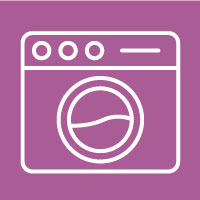Wann kommt in den Abendnachrichten schon mal das Thema Schriftarten vor? Als das US-Außenministerium kürzlich die Calibri amtlich aus- und die Times New Roman wieder einwechselte, wirkte die Typografie plötzlich wie ein Kulturkampf in 48 Punkt.
Von Stefan Brunn
Worum geht’s eigentlich?
Das US-Außenministerium (State Department) hat im Dezember per Direktive angeordnet, für offizielle Kommunikation nur noch Times New Roman zu verwenden und nicht mehr Calibri. Begründung: Die Times stehe eher für Respektabilität, Professionalität, Glaubwürdigkeit. Die Calibri hingegen wird als unnütze und ideologische DEIA-Maßnahme der Vorgänger-Regierung dargestellt. DEIA steht für Diversity, Equity, Inclusion und Accessibility, also Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion und Barrierefreiheit.
Gilt der Schriftenwechsel für die gesamte US-Bundesverwaltung?
Nein, obwohl es in vielen Medien so rüberkam. Derzeit gilt er aber nur für das State Department der USA.
Wie können Schriftarten denn überhaupt politisch sein?
Schriften sind wie Stimmen am Telefon: Man versteht den Inhalt – aber man hört auch die Haltung. Serifenschriften wie die Times wirken/klingen oft kultivierter und traditioneller, Serifenlose wie die Calibri eher informeller und moderner. Wenn Times New Roman der dunkle Anzug mit Krawatte ist, stellt die Calibri eher das aufgeknöpfte Hemd dar. Aber wenn ein Ministerium den Anzug zur Pflicht erklärt, ist das nicht nur Mode.
Gibt es andere Beispiele für politische Schrift-Entscheidungen?
Oh ja, sogar reihenweise und auf viel größerer Basis. Man denke nur an den Erlass Deutschlands von 1941, Frakturschriften zugunsten von Antiqua-Schriften (das sind die Serifenschriften) abzuschaffen. Oder an die Alphabetreform der Türkei von 1928, als man von der arabischen Schrift zum lateinischen Alphabet wechselte. In den letzten Jahrzehnten ging es aber in vielen Behörden der Welt (unter anderem in Australien, Großbritannien, Kanada oder Neuseeland) eher darum, mit serifenlosen Schriften die Lesbarkeit des Geschriebenen zu erhöhen, vor allem im Web. Im Internet verkrisseln schon mal die Serifen (das sind die kleinen Füßchen an den Buchstabenenden bei der Times).
Ist denn die Calibri eine besser lesbare Schrift?
Tja, die Calibri ist eine sehr gut lesbare Schrift, weshalb wir sie zum Beispiel in Seminarunterlagen sehr gern verwenden. Aber erstens ist die Times New Roman auch sehr gut lesbar, wenn man nicht gerade Kleinstfußnoten auf einem pixeligen Handymonitor liest. Und zweitens weiß jeder Experte aus Studien: Die Leserlichkeit hängt hauptsächlich von ganz anderen Faktoren ab. Das sind vor allem Schriftgröße, Zeilenlänge und Zeilenabstand. Anders sieht es nur aus, wenn man ganz ungewöhnliche Schriften verwendet (irgendwelche Schmuckschriften zum Beispiel), aber dazu gehören weder Times New Roman noch Calibri.
Welche Schriften verwenden denn deutsche Bundesbehörden?
Die Bundesregierung hat eigene Hausschriften (BundesSans/BundesSerif) definiert. In der Praxis werden diese Schriften oft, aber längst nicht immer verwendet (zum stöhnenden Leidwesen der Corporate-Design-Beauftragten). Bei der Einführung dieser Schriften ging es aber nicht um eine politische Ideologie vom Typ „Wir ändern die Sprache!“. Sondern man zielte auf Einheitlichkeit, Modernisierung und auch Leserlichkeit.
Welche Schriften sind denn tatsächlich am besten lesbar?
Es gibt Schriften, die explizit für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen entworfen wurden und die somit auch alle anderen leichter lesen. Das Braille-Institut etwa hat die Atkinson Hyperlegible geschaffen, die auf maximale Zeichen-Unterscheidbarkeit (etwa O/0, I/l/1 etc.) setzt. Das American Printing House for the Blind hat die ebenfalls gratis verfügbare APHont herausgebracht. Aus Frankreich stammt die Luciole, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle. All diese Schriften kann man kostenlos herunterladen und verwenden.
Was ist der Nachteil dieser extra-barrierefreien Schriften?
Diese Schriften sind nicht weit verbreitet. Meist liegen Schriften ja lokal auf dem Rechner, und wenn ein Dokument geöffnet wird und die Schriftart fehlt, wird wahllos irgendeine andere Schrift angezeigt. Beim Austausch von Dateien aus Word, PowerPoint oder InDesign empfiehlt es sich daher, eine der wenigen Schriften zu verwenden, die auf allen Rechnern weltweit vorinstalliert ist. Dazu gehören sowohl Calibri als auch Times New Roman. Deshalb arbeiten wir fast immer, wenn wir offene Dateien mit anderen austauschen, mit Calibri.

Neugierig geworden?
Wir von IMKIS lieben es, Entwicklungen rund um Kommunikation und Sprache zu durchleuchten – und geben dieses Wissen auch in Seminaren weiter. Vielleicht finden auch Sie etwas in unserem Portfolio?
UNSERE SEMINARE